Viele Kinder haben nicht nur eine Lernstörung – Dyskalkulie und Legasthenie treten häufig gemeinsam auf. Hinzu kommen oft weitere Herausforderungen wie Aufmerksamkeitschwierigkeiten, Ängste oder psychosomatische Beschwerden.
In diesem Artikel erfährst du:
- welche Schwierigkeiten häufig zusammen mit Dyskalkulie und Legasthenie auftreten und was Komorbiditäten genau sind
- warum es so wichtig ist, diese bei der Förderung zu berücksichtigen
- und was ich Eltern, aber auch Lerntherapeuten empfehle
Was bedeutet „Komorbidität“?
Der Begriff Komorbidität beschreibt das gleichzeitige Auftreten von zwei oder mehr Störungen bei einer Person. Bezogen auf Lernstörungen heißt das: Ein Kind hat nicht nur Probleme in einem Bereich, sondern gleichzeitig zusätzliche Herausforderungen– zum Beispiel im Bereich Aufmerksamkeit, Sprache oder Emotionen.
Dyskalkulie und Legasthenie – eine häufige Kombination
Eine Lese-Rechtschreibstörung (LRS/Legasthenie) und eine Rechenstörung (Dyskalkulie) können gleichzeitig auftreten und tatsächlich ist das gar nicht so selten.
Die S3-Leitlinie Rechenstörung (DGKJ, 2018) beschreibt „Die hohe Komorbidität zwischen der Rechenstörung und der Lese-und/oder Rechtschreibstörung ist gut belegt.“ Studien zeigen, dass Kinder mit LRS ein vier- bis fünffach erhöhtes Risiko haben, zusätzlich eine Dyskalkulie zu entwickeln. Die Prävalenzraten liegen je nach Studie zwischen 20 und 40 %.
Auch auf der Plattform Londi (LMU München & DIPF) findet man Folgendes: „Etwa jedes dritte Kind mit einer Rechenstörung hat zusätzlich besondere Lernschwierigkeiten beim Lesen und/oder beim Rechtschreiben.“ (londi.de)
Für die betroffenen Kinder bedeutet das eine doppelte Belastung: Sie kämpfen nicht nur mit Zahlen, sondern auch mit Buchstaben. Das Selbstbewusstsein leidet, die schulischen Anforderungen erscheinen oft überwältigend.
Häufige Komorbiditäten – Übersicht
Neben der Kombination aus Dyskalkulie und Legasthenie treten häufig weitere Begleiterkrankungen auf. Hier ein Überblick über die häufigsten Komorbiditäten:
- ADHS/ADS – Aufmerksamkeitsprobleme, Impulsivität, Konzentrationsschwäche
- Ängste und depressive Symptome – Prüfungsangst, Rückzug, Traurigkeit, geringer Selbstwert
- Aggressives oder oppositionelles Verhalten – impulsiv, verweigernd, störend
- Körperliche Beschwerden – Bauchschmerzen, Kopfschmerzen, Übelkeit, besonders vor Prüfungen
- Sprachentwicklungsstörungen oder Auditive Verarbeitungs-und Warnehmungsstörungen (AVWS) – besonders bei LRS
Diese Übersicht zeigt, wie vielfältig Begleiterkrankungen sein können. In den folgenden Abschnitten gehe ich auf einzelne Komorbiditäten näher ein und erkläre, welche Bedeutung sie für Schule, Familie und Förderung haben.
ADHS/ADS – Aufmerksamkeitsprobleme, Impulsivität, Konzentrationsschwäche
Etwa 30 % der Kinder mit Dyskalkulie oder Legasthenie zeigen zusätzlich Symptome einer Aufmerksamkeitsstörung. Dabei haben die Schüler insbesondere Herausforderungen mit einer mangelhaften Aufmerksamkeitssteuerung und einer Ablenkbarkeit.
Beim Rechnen zeigt sich das zum Beispiel in Flüchtigkeitsfehlern: Ein vergessener Übertrag oder ein nicht notiertes Zwischenergebnis können dazu führen, dass die komplette Aufgabe falsch ist. Kinder mit ADHS/ADS haben oft Schwierigkeiten, mehrschrittige Aufgaben zu strukturieren, irrelevante Informationen auszublenden und die Reihenfolge einzuhalten.
Mehr Informationen findest du in unserem kostenlosen Elternratgeber „Handreichungen für Eltern von Kindern/Jugendlichen mit einer Dyskalkulie“ von Dr. Silvia Pixner und Susanne Seyfried (2001), den du hier kostenlos herunterladen kannst.
Ängste und depressive Symptome
Viele Kinder mit Dyskalkulie oder Legasthenie entwickeln im Laufe der Zeit Ängste, die durch wiederholte Misserfolge in der Schule entstehen. Typisch sind:
- Prüfungsangst – starke Nervosität vor Klassenarbeiten.
- Matheangst – die Angst vor Zahlen und Rechenaufgaben, oft schon ab der Grundschule.
- Sozialer Rückzug – Kinder wirken still, angepasst und stören nicht.
- Depressive Verstimmungen – anhaltende Traurigkeit, Selbstzweifel, wenig Motivation
In der Fachsprache spricht man von „internalisierenden Symptomen“, weil die Probleme eher „nach innen gerichtet“ sind und von außen oft unauffällig wirken. Gerade deshalb werden diese Kinder im Unterricht leicht übersehen.
Besonders gut untersucht ist die Matheangst: Studien zeigen, dass rund ein Drittel aller Kinder davon betroffen ist – bei Kindern mit Dyskalkulie sogar doppelt so häufig (Zuber & Kucian, 2017). Mehr dazu findest du in meinem Artikel zur Matheangst.
Körperliche Beschwerden – Bauchschmerzen, Kopfschmerzen, Übelkeit
Lernstörungen zeigen sich nicht nur in den schulischen Leistungen, sondern oft auch im Körper. Viele Kinder mit Dyskalkulie oder Legasthenie klagen vor Klassenarbeiten oder Tests über Bauchschmerzen, Kopfschmerzen oder Übelkeit. Solche Beschwerden treten besonders in stressigen Situationen auf und können ein deutlicher Hinweis auf Ängste oder Überforderung sein. Wichtig ist, dass Eltern und Lehrkräfte diese Signale ernst nehmen: Der Körper macht sichtbar, wie belastend die Schulsituation für das Kind ist.
Lernstörungen gehen oft weit über schulische Probleme hinaus. Die PuLs-Studie (Huck & Schröder, 2016) zeigt: Fast 70 % der Kinder mit Lese-Rechtschreib- oder Rechenschwäche litten unter mindestens einer psychosozialen Belastung – sei es in Form von Ängsten, depressiven Symptomen oder körperlichen Beschwerden ohne organische Ursache. Bei 16 % waren es sogar drei oder mehr. Das verdeutlicht: Psychische und körperliche Reaktionen sind eng miteinander verbunden – und ein Hinweis darauf, wie ernst Eltern und Lehrkräfte diese Signale nehmen sollten.
Warum eine fundierte Anamnese so wichtig ist
Damit Lerntherapie wirksam sein kann, ist es entscheidend, dass alle relevanten Informationen von Anfang an berücksichtigt werden. Oft sind es nicht nur die offensichtlichen Schwierigkeiten im Lesen, Schreiben oder Rechnen, sondern auch andere Aspekte, die den Lernerfolg beeinflussen können – zum Beispiel eine Frühgeburt, Seh- oder Hörprobleme, eine Auditive Verarbeitungs- und Wahrnehmungsstörung (AVWS) oder auch Ängste. Auch ohne Diagnose lohnt es sich, solche Beobachtungen mitzuteilen.
Was Eltern beachten sollten
Eltern kennen ihr Kind am besten. Sie können wertvolle Hinweise geben, die Lerntherapeuten sonst gar nicht erfahren würden. Deshalb gilt: Schon kleine Auffälligkeiten – etwa Schlafprobleme, morgendliche Bauchschmerzen oder eine besonders hohe Ablenkbarkeit – können Hinweise auf zusätzliche Belastungen sein.
Offene Kommunikation ist keine Schwäche, sondern eine Stärke: Sie hilft, die Lernschwierigkeiten ganzheitlich zu verstehen und die Förderung gezielt darauf abzustimmen. Mehr dazu liest du in meinem Artikel zur Anamnese in der Lerntherapie und zum Thema Frühgeburt und Lernen.
Was für Lerntherapeuten wichtig ist
Für Lerntherapeuten bedeutet das: genau hinschauen, gezielt nachfragen und die gesamte Lebens- und Lerngeschichte des Kindes einbeziehen. Eine sorgfältige Anamnese ist die Grundlage, um die passenden Schwerpunkte in der Förderung zu setzen.
Gleichzeitig ist es wichtig, die eigenen Grenzen zu kennen: Wenn Auffälligkeiten außerhalb der lerntherapeutischen Förderung liegen – etwa starke Ängste, depressive Symptome oder deutliche Sprachprobleme – sollte frühzeitig auf andere Fachleute (Psychotherapie, Logopädie, Ergotherapie, Kinderärzte) verwiesen werden.
Lernstörungen ganzheitlich verstehen und Kinder stärken
Dyskalkulie und Legasthenie treten selten allein auf. Viele Kinder zeigen zusätzliche Auffälligkeiten wie ADHS, Ängste oder psychosomatische Beschwerden. Für Eltern und Lehrkräfte ist es deshalb entscheidend, das gesamte Bild zu sehen – nicht nur die Schwierigkeiten im Lesen, Schreiben oder Rechnen.
Eine Lerntherapie ist immer eine ganzheitliche Förderung, die auch mögliche Komorbiditäten berücksichtigt. Lerntherapeuten spielen dabei eine zentrale Rolle: Sie haben die Lernstörung im Blick, arbeiten aber zugleich mit anderen Experten zusammen, wenn psychische, motorische oder sprachliche Herausforderungen hinzukommen.
So entsteht ein Weg, der Kinder nicht nur schulisch stärkt, sondern ihnen auch Selbstvertrauen, Motivation und neue Freude am Lernen zurückgibt.
In weiteren Artikeln erfährst du mehr über Themen wie Matheangst, Anamnese in der Lerntherapie oder den Nachteilsausgleich bei LRS und Dyskalkulie. Spannend finde ich auch, dass ADHS auch erst im Erwachsenenalter auftreten kann, schau doch gerne mal bei Judith Peters vorbei.
Mehr Impulse – kannst du haben:-)
Du willst regelmäßig Tipps rund um Dyskalkulie, Legasthenie und Lernförderung erhalten? Dann abonniere meinen Newsletter und bleibe immer auf dem Laufenden.
Quellen:
Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie (DGKJP). (2018). S3-Leitlinie Rechenstörung zuletzt aufgerufen am 21.9.2025 unter AWMF Leitlinienregister
Huck, L., & Schröder, A. (2016). PuLs-Studie: Psychosoziale Belastungen und Lernschwierigkeiten – Eine Untersuchung der psychosozialen Belastungen bei Kindern mit Lese-Rechtschreib- oder Rechenschwäche. Duden Institute für Lerntherapie. https://www.duden-institute.de/Infothek/Studien/10316_PuLs_Studie.htm
LONDI Lernstörungen, Online Plattform für Diagnostik und Intervention: : Verantwortlich: Prof. Dr. Gerd Schulte-Körne (LMU München), Prof. Marcus Hasselhorn (DIPF) et al.
Pixner, S., & Seyfried, S. (2021). Handreichungen für Eltern von Kindern/Jugendlichen mit einer Dyskalkulie (1. Aufl.). Bundesverband Legasthenie und Dyskalkulie e. V., Bonn
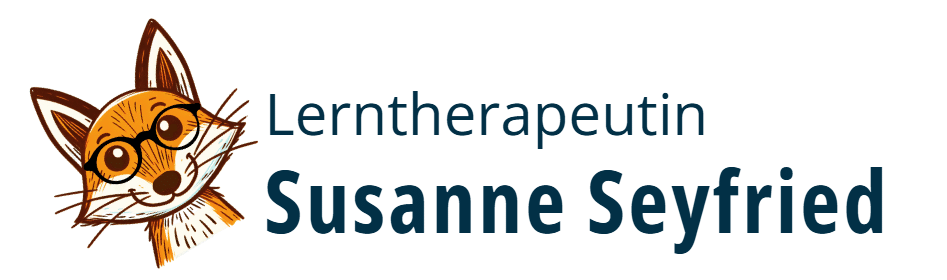



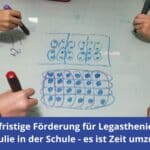


4 Comments